
Geschichte pur - die Historie von Gut Elmarshausen
Egelmareshusen 1123. Elimareshusen 1150. Eilmarshusen 1255. Elmershusen
1314. - Ursprünglich Dorf. Im 13. Jahrhundert im Besitz derer v. Helfenberg als
Lehen der Grafen v. Everstein. Im 14. Jahrhundert an die v. Gudenberg verkauft.
1452 wird Heinrich v. Gudenberg vom Herzog v. Braunschweig mit Elmarshausen
belehnt. Nach dem Aussterben der v. Gudenberg 1534 wird Feldmarschall
Hermann v.d. Malsburg mit Elmarshausen belehnt, der schon 1515 das Gut
erwarb. Seitdem im Besitz der Familie v.d. Malsburg (bis 1955), Elsner v. Gronow
(bis 1980), nun: Elsner v.d. Malsburg.
Hermann v.d. Malsburg war Hof- und Feldmarschall des Landgrafen Philipp v.
Hessen in Marburg und Generalfeldmarschall Herzog Ulrichs v. Württemberg, der
bei Philipp Zuflucht gefunden hatte, nachdem er 1519 vom Schwäbischen Bund
vertrieben worden war. Hermann v.d. Malsburg gewann ihm dann durch den Sieg
bei Lauffen a.N. 13.5.1534 sein Land zurück (das Heer von König Ferdinand, dem
Bruder des habsburgischen Kaisers Karl V. und Regenten in Württemberg, in die
Flucht geschlagen; 2 Tage später zog er wieder in seine Residenzstadt Stuttgart
ein; er verhalf der im Marburger Religionsgespräch v. 1529 kennengelernten
Reformation nun zum Zuge).
Im gleichen Jahr wurde er mit einer Dotation belohnt, so dass er finanziell in der
Lage war, die schon 1442 von den v. Gudenberg erbaute Burg (von diesem Bau
Südflügel erhalten) vollständig umzubauen und zu erweitern (örtlicher Sandstein).
Nach dem Tode Hermanns 1557 wurde der Bau fortgeführt und vollendet von
seinem Sohn Christoph (aus erster Ehe mit Anna v. Hundelshausen). Seinen
vorläufigen Abschluss fand das Bauwerk 1563 durch die Errichtung des Nordost-
und Nordflügels (s. Bauinschriften).
G. Ganßauge hält den schwäbischen Baumeister Jörg Unkair, der 1524 - 1553
mehrere Schlossbauten (Neuhaus, Schelenburg, Stadthagen, Petershagen u.
Detmold) errichtete, auch aus stilkritischen Gründen für den möglichen Erbauer.
Immerhin ist Meister 'Jürgen v. Tübingen' seinem Landesherren nach dem
Abbruch der Bauarbeiten am Hohentübingen 1519 (Vertreibungsjahr) nach
Norden gefolgt, und da er nach Stadthagen, d.h. um 1540 bis zum Baubeginn in
Petershagen 1544 unseres Wissens an keinem anderen Bauvorhaben beteiligt
war, hat diese Theorie viel für sich, obwohl sein Meisterzeichen in Elmarshausen
nicht gefunden wurde. Dagegen kehrten Steinmetzzeichen vom Schloss Neuhaus
wieder.



Um 1740 Umbau und Erneuerung der Ausstattung der Schlosskapelle. Weihe am
18. Oktober 1742 (mit Stiftung der jährlichen Armenspeisung) durch Friedrich
Anton v.d. Malsburg (1693 - 1760) und seiner Gemahlin Agnes,geb. v. Spörken
(1704 -1776), verm. 1733). Die Nordseite des Hofes und der runde Treppenturm in
der Nordwestecke 1881 (s. Bauinschrift). 1906 Wiederherstellung des
Südwestturmes nach Zerstörung durch Blitzschlag. 1909 Erneuerung des
Hauptportals im Hof. Die Kapelle war 1747 Filial v. Oberelsungen, später dorthin
eingepfarrt. Jetzt Filiale der Renitengemeinde Balhorn. Kirchenbücher seit 1600.
1945/46 von alliierten Truppen mehrfach besetzt und ruiniert.
Das wesentliche und nennenswerte Inventar wurde gestohlen bzw. deportiert
und gilt bis heute als verschollen. 1947 - 1959 entschädigungslose Enteignung von
zwei zugehörigen Gutsbetrieben für Siedlungszwecke, davon einer vom Siedler in
den 70er Jahren an die Kurhessische Landeskirche bestens verkauft; dem
enteigneten Vorbesitzer wurde kein Rückkaufsrecht oder Erlösanteil zugestanden.
1979 - 1984 Renovierung der Ost-, Nord- und Westfassade mit statischer
Sanierung des Ostflügels (nördl. Giebelwand, Osttorbau mit gesamter
Dachkonstruktion).



Bestand
Die Schlossanlage (aus Bruch- und Werkstein, gelegentlich Lehmfachwerk od. Ziegelstein) umschließt einen etwa quadratischen Hof, rings umgeben von einem z.T. unmittelbar an das Gebäude herantretenden gemauerten Wassergraben (Grefte/Graft). An der Süd- u. Westseite der Wohnbau, im Westen mit nördl. anschließendem Tor und Pförtnerwohnung, im Osten der Kapellenbau, nördl. daran anschließend ein jüngerer Wohnbau mit Torgang und befestigtem Tor. Zwischen dem Ost- und Westflügel nördl. des Tores ein eingeschobener Verbindungsbau. Das gesamte Gebäudeviereck wird durch Kehlsockel, Kaffgesims und Traufkehle einheitlich umzogen. Der Torflügel des Wohnhauses und der Nebenbau mit Satteldach in Biberschwanzdeckung, das übrige höherliegende Dach in Schieferdeckung. Hier ursprünglich halbrunde Steingiebelchen mit Kugelaufsätzen (welsche Giebel), nur über dem Nordteil, der Ostfront und am Nordgiebel des Wohnbaus, sowie über dem nördlichen Treppengiebel des Ostgiebels erhalten, die übrigen wurden durch Dreiecksgiebel ersetzt. Ein Anblick von Osten (Wirtschaftshof) zeigt die beiden erhaltenen Zwerchhäuser und die Ausflucht, sowie die Rückseite des Treppengiebels, die sämtlich von welschen Giebeln bekrönt sind. Die Zwerchhäuser stehen so dicht nebeneinander, dass sie das Dach vollständig verdecken.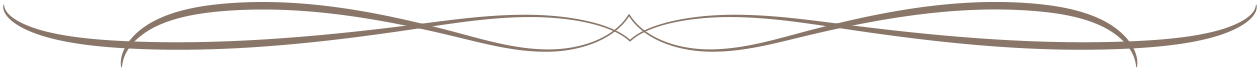

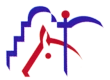
Gut Elmarshausen

© 2025 Gut Elmarshausen
05692 - 99 50 33

05692 - 99 50 34
Quellen
• Die Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Kassel", 1. Bd. Kreis Wolfhagen. Bearbeitet von G. Ganßauge, W. Kramm, W. Medding, Kassel 1937, Elmarshausen, S. 222-227. • "Das Schloss Elmarshausen" in "Hessische Heimat", 10. Jg. 1966 Heft 1, S. 4-10 von G. Ganßauge. • Staatsarchiv Marburg, • von der Malsburgisches Familienarchiv, • Urkunden und Hessische Urkunden 1296 - 1370, • Hasunger Urkunden 1314, 1447; • Stadtarchiv Wolfhagen: Urkunden.
Zucht Aufzucht Besamungsstation
Gut Elmarshausen
Dr. Elke Söchtig
34466 Wolfhagen-Elmarshausen
SOCIAL MEDIA

Zucht Aufzucht Besamungsstation
Geschichte pur!
Die Historie von Gut Elmarshausen
Egelmareshusen 1123. Elimareshusen 1150.
Eilmarshusen 1255. Elmershusen 1314. -
Ursprünglich Dorf. Im 13. Jahrhundert im Besitz
derer v. Helfenberg als Lehen der Grafen v.
Everstein. Im 14. Jahrhundert an die v.
Gudenberg verkauft. 1452 wird Heinrich v.
Gudenberg vom Herzog v. Braunschweig mit
Elmarshausen belehnt. Nach dem Aussterben
der v. Gudenberg 1534 wird Feldmarschall
Hermann v.d. Malsburg mit Elmarshausen
belehnt, der schon 1515 das Gut erwarb.
Seitdem im Besitz der Familie v.d. Malsburg (bis
1955), Elsner v. Gronow (bis 1980), nun: Elsner
v.d. Malsburg.
Hermann v.d. Malsburg war Hof- und
Feldmarschall des Landgrafen Philipp v. Hessen
in Marburg und Generalfeldmarschall Herzog
Ulrichs v. Württemberg, der bei Philipp Zuflucht
gefunden hatte, nachdem er 1519 vom
Schwäbischen Bund vertrieben worden war.
Hermann v.d. Malsburg gewann ihm dann durch
den Sieg bei Lauffen a.N. 13.5.1534 sein Land
zurück (das Heer von König Ferdinand, dem
Bruder des habsburgischen Kaisers Karl V. und
Regenten in Württemberg, in die Flucht
geschlagen; 2 Tage später zog er wieder in seine
Residenzstadt Stuttgart ein; er verhalf der im
Marburger Religionsgespräch v. 1529
kennengelernten Reformation nun zum Zuge).

Im gleichen Jahr wurde er mit einer Dotation
belohnt, so dass er finanziell in der Lage war, die
schon 1442 von den v. Gudenberg erbaute Burg
(von diesem Bau Südflügel erhalten) vollständig
umzubauen und zu erweitern (örtlicher
Sandstein).
Nach dem Tode Hermanns 1557 wurde der Bau
fortgeführt und vollendet von seinem Sohn
Christoph (aus erster Ehe mit Anna v.
Hundelshausen). Seinen vorläufigen Abschluss
fand das Bauwerk 1563 durch die Errichtung des
Nordost- und Nordflügels (s. Bauinschriften).
G. Ganßauge hält den schwäbischen Baumeister
Jörg Unkair, der 1524 - 1553 mehrere
Schlossbauten (Neuhaus, Schelenburg,
Stadthagen, Petershagen u. Detmold) errichtete,
auch aus stilkritischen Gründen für den
möglichen Erbauer. Immerhin ist Meister 'Jürgen
v. Tübingen' seinem Landesherren nach dem
Abbruch der Bauarbeiten am Hohentübingen
1519 (Vertreibungsjahr) nach Norden gefolgt,
und da er nach Stadthagen, d.h. um 1540 bis
zum Baubeginn in Petershagen 1544 unseres
Wissens an keinem anderen Bauvorhaben
beteiligt war, hat diese Theorie viel für sich,
obwohl sein Meisterzeichen in Elmarshausen
nicht gefunden wurde. Dagegen kehrten
Steinmetzzeichen vom Schloss Neuhaus wieder.

Um 1740 Umbau und Erneuerung der
Ausstattung der Schlosskapelle. Weihe am 18.
Oktober 1742 (mit Stiftung der jährlichen
Armenspeisung) durch Friedrich Anton v.d.
Malsburg (1693 - 1760) und seiner Gemahlin
Agnes,geb. v. Spörken (1704 -1776), verm. 1733).
Die Nordseite des Hofes und der runde
Treppenturm in der Nordwestecke 1881 (s.
Bauinschrift). 1906 Wiederherstellung des
Südwestturmes nach Zerstörung durch
Blitzschlag. 1909 Erneuerung des Hauptportals
im Hof. Die Kapelle war 1747 Filial v.
Oberelsungen, später dorthin eingepfarrt. Jetzt
Filiale der Renitengemeinde Balhorn.
Kirchenbücher seit 1600.
1945/46 von alliierten Truppen mehrfach besetzt
und ruiniert.

Das wesentliche und nennenswerte Inventar
wurde gestohlen bzw. deportiert und gilt bis
heute als verschollen. 1947 - 1959
entschädigungslose Enteignung von zwei
zugehörigen Gutsbetrieben für Siedlungszwecke,
davon einer vom Siedler in den 70er Jahren an
die Kurhessische Landeskirche bestens verkauft;
dem enteigneten Vorbesitzer wurde kein
Rückkaufsrecht oder Erlösanteil zugestanden.
1979 - 1984 Renovierung der Ost-, Nord- und
Westfassade mit statischer Sanierung des
Ostflügels (nördl. Giebelwand, Osttorbau mit
gesamter Dachkonstruktion).
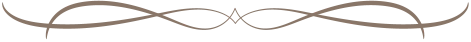
Bestand
Die Schlossanlage (aus Bruch- und Werkstein, gelegentlich Lehmfachwerk od. Ziegelstein) umschließt einen etwa quadratischen Hof, rings umgeben von einem z.T. unmittelbar an das Gebäude herantretenden gemauerten Wassergraben (Grefte/Graft). An der Süd- u. Westseite der Wohnbau, im Westen mit nördl. anschließendem Tor und Pförtnerwohnung, im Osten der Kapellenbau, nördl. daran anschließend ein jüngerer Wohnbau mit Torgang und befestigtem Tor. Zwischen dem Ost- und Westflügel nördl. des Tores ein eingeschobener Verbindungsbau. Das gesamte Gebäudeviereck wird durch Kehlsockel, Kaffgesims und Traufkehle einheitlich umzogen. Der Torflügel des Wohnhauses und der Nebenbau mit Satteldach in Biberschwanzdeckung, das übrige höherliegende Dach in Schieferdeckung. Hier ursprünglich halbrunde Steingiebelchen mit Kugelaufsätzen (welsche Giebel), nur über dem Nordteil, der Ostfront und am Nordgiebel des Wohnbaus, sowie über dem nördlichen Treppengiebel des Ostgiebels erhalten, die übrigen wurden durch Dreiecksgiebel ersetzt. Ein Anblick von Osten (Wirtschaftshof) zeigt die beiden erhaltenen Zwerchhäuser und die Ausflucht, sowie die Rückseite des Treppengiebels, die sämtlich von welschen Giebeln bekrönt sind. Die Zwerchhäuser stehen so dicht nebeneinander, dass sie das Dach vollständig verdecken.Quellen
• Die Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Kassel", 1. Bd. Kreis Wolfhagen. Bearbeitet von G. Ganßauge, W. Kramm, W. Medding, Kassel 1937, Elmarshausen, S. 222-227. • "Das Schloss Elmarshausen" in "Hessische Heimat", 10. Jg. 1966 Heft 1, S. 4-10 von G. Ganßauge. • Staatsarchiv Marburg, • von der Malsburgisches Familienarchiv, • Urkunden und Hessische Urkunden 1296 - 1370, • Hasunger Urkunden 1314, 1447; • Stadtarchiv Wolfhagen: Urkunden.

Gut
Elmarshausen

Gut Elmarshausen
Dr. Elke Söchtig
34466 Wolfhagen-Elmarshausen
05692 - 99 50 33

05692 - 99 50 34
© 2025 Gut Elmarshausen
SOCIAL MEDIA













